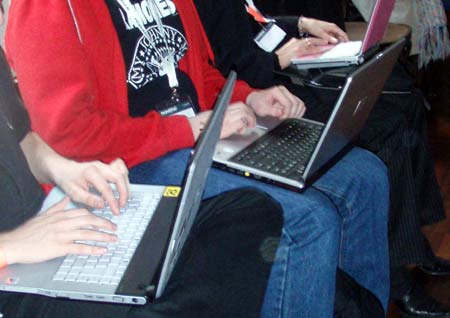Markus Beckedahl und Johnny Haeusler bei der Eröffnung: „Es hat nicht zufällig jemand ’n Laptop dabei?“


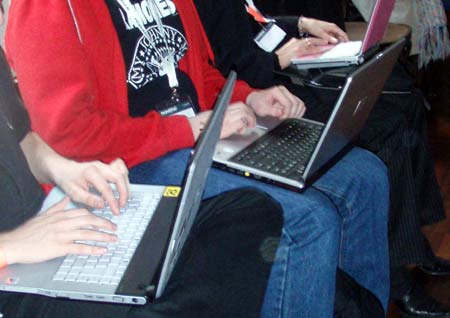

Kurz vor 16 Uhr, ich komme endlich dazu, einen Happen zu essen – und der einzige freie Platz, den ich in der Kalkscheune finde, ist der neben dem Videoschirm, auf dem Felix Schwenzel, mit dem Laptop auf einem Klodeckel sitzend, aus wirres.net dauer-liest. Mahlzeit.
Nette Idee: Sämtliche Veranstaltungen im Hauptsaal sind live kommentierbar – per SMS. Jede Kurznachricht wird auf einer Leinwand vorne dargestellt (ein, zwei Bilder davon auch hier). Der Vortrag von Torsten Kleinz über Trolle im Netz ist eben zuende gegangen, jetzt heißt das Thema: „Brauchen wir eine Blog-Etikette? Wieviel Verantwortung braucht das Netz?“ Auf dem Podium (Pännel, muss man ja heutzutage sagen): Stefan Niggemeier, Don Dahlmann, Rainer Kuhlen (Uni Konstanz), Johnny Haeusler (Moderation).
(„Warum sitzen die Trolle jetzt vorne?“, hat eben jemand auf die Leinwand gesimst.)
 Die Ethik der Schweine ist der Stall, sagt Prof. Dr. Rainer Kuhlen von der Uni Konstanz. Oder anders ausgedrückt: Unser Verhalten hängt von unserem Aufenthaltsort ab, von unserem Umfeld, verdichtet sich zu Normen, Regeln, Etiketten – und irgendwann kommen die Philosophen und machen daraus Ethik. Wir bewegen uns im Netz, brauchen also Regeln für diesen Bereich. Eine Netiquette gibt es längst. Aber: Wenn sich jemand nicht dran hält, sind (wirksame) Sanktionen nicht durchsetzbar.
Die Ethik der Schweine ist der Stall, sagt Prof. Dr. Rainer Kuhlen von der Uni Konstanz. Oder anders ausgedrückt: Unser Verhalten hängt von unserem Aufenthaltsort ab, von unserem Umfeld, verdichtet sich zu Normen, Regeln, Etiketten – und irgendwann kommen die Philosophen und machen daraus Ethik. Wir bewegen uns im Netz, brauchen also Regeln für diesen Bereich. Eine Netiquette gibt es längst. Aber: Wenn sich jemand nicht dran hält, sind (wirksame) Sanktionen nicht durchsetzbar.
Don Dahlmann meint: Man wird immer zehn, fünfzehn Prozent Idioten haben. Für diese wenigen sollte man keine Regeln aufstellen, wenn sich mehr als 80 Prozent der Leute im Netz benehmen.
Kuhlen: Bloggertexte sind meist pragmatische Texte. Schwierigkeit: Man weiß bei der anonymen Leserschaft oft nicht, wie ein Text aufgefasst wird – das Haupt-Dilemma. Denn jeder Blogger sollte sich über mögliche Konsequenzen im Voraus Gedanken machen. Als Journalist schreibe ich aber doch vielmehr in einen anonymen Raum rein, meint Stefan Niggemeier. Kuhlen: Journalisten erwarten gar keine Reaktionen, Blogtexte dagegen sind auf Wirkung, auf Reaktion hin geschrieben.
Der Fall der bedrohten Bloggerin Kathy Sierra wird herangezogen, um über Vor- und Nachteile von Anonymität zu sprechen. Ein Verbot von Anonymität im Netz würde Kreativität, Spontaneität mindern, warnt Kuhlen.
Der Sierra-Verleger O’Reilly hatte nach dem Vorfall folgenden Bloggerkodex vorgeschlagen:
- We take responsibility for our own words and for the comments
- We won’t say anything online that we wouldn’t say in person
- We connect privately before we respond publicly
- When we believe someone is unfairly attacking another, we take action
- We do not allow anonymous comments
- We ignore trolls
Don Dahlmann: Wenn du das Internet nutzen willst, dann musst du auch damit rechnen, das andere es genauso nutzen – du kannst nicht nur das eine (das „Gute“) im Netz haben, ohne das andere, die Trolle, die Deppen usw.
Frage aus dem Publikum per SMS-Kommentar: Wenn man das alles zulassen kann/muss/soll, von was für Sanktionen reden wir dann? Welche Etikette macht Sinn, wenn man sie nicht durchsetzen kann?
Stefan Niggemeier: Ich habe gerade das dringende Bedürfnis, über Don Alphonso zu reden. In seinem Blog gelten bestimmte Regeln nicht – Kommentare werden, nach Vorankündigung, gelöscht, Quellen nicht verlinkt, um keinen Traffic zu generieren… Es gibt Leute, die sich andere Regeln geben, und die somit auch andere Diskussionen ermöglichen.
Thilo Baum (im Publikum): Hat es Sinn, Regeln aufzustellen, die die vorhin erwähnten fünfzehn Prozent Idioten eh nicht interessieren – denn die halten sich eben gerade an diese Regeln nicht?
SMS-Kommentar: Wir sind nicht im Krieg, wir schreiben Zeug auf Webseiten.
Thomas Wiegold (im Publikum): Mich stört an der Fragestellung, dass so getan wird, als seien alle Blogger über einen Kamm zu scheren. An große Blogs werden ganz andere Erwartungen gestellt als an kleine. Müssen wir bei Regeln nicht differenzieren?
Thilo Baum (im Publikum): Ich überprüfe jeden Kommentar auf medienrechtliche Relevanz. Blogger sollten sich in Medienrecht schlau machen – Beleidigungen, Schmähkritiken kann man auch als Laie erkennen, aber nicht, was darüber hinausgeht.
Don Dahlmann: Diese Herangehensweise ist für Blogs Quatsch – das ist der alte Gatekeeping-Gedanke, der so nicht mehr funktioniert.
SMS-Kommentar: Die Diskussion über die Blog-Etikette ist wichtiger als die Etikette selbst.
Marcel vom Parteibuch (im Publikum): Wir sollten lieber darüber nachdenken, wie wir die Regeln lockern können, die es schon gibt. Nicht jeder ist als Medienrechtler geboren. Jeder sollte lernen dürfen, jeder sollte eine Stimme haben können. Man darf in Deutschland viele wahre Dinge nicht behaupten, weil sie einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht darstellen.
Thomas Wiegold (im Publikum): Die Blogosphäre funktioniert anders als ein Printmedium, deshalb kann man hier mehr zulassen. Heute Morgen habe ich einen heiklen Kommentar im Blog zugelassen, der als Leserbrief sofort in den Papierkorb gewandert wäre, und es geschah, was ich gehofft hatte: Die Behauptung (es ging um die Wehrmacht) wurde von anderen Kommentatoren sehr schnell konterkariert.
Don Dahlmann: Auch der Rezipient, der Blogleser, braucht Medienkompetenz – er sollte anfangen, über den Informationswert nachzudenken, sowohl bei klassischen Medien als auch bei Blogs, und diesen wichtigen Prozess haben Blogs angetrieben.
Karsten Wenzlaff (im Publikum): Blogger sind ein konservativer und schizophrener Haufen. Einige versauen die Reputation der Blogosphäre durch zweifelhafte Reklame – das gehört in eine Diskussion über Blog-Ethik auch hinein.
Johnny Haeusler: Über Werbung in Weblogs haben wir morgen ausreichend Gelegenheit zur Diskussion…
Das war’s von dieser Veranstaltung. Weiter mit Musik.
Disclaimer: Es handelt sich um sinngemäße Zitate, nicht notwendig wörtliche – ich bitte alle Erwähnten um Verständnis und um Hinweis, wenn sich jemand falsch wiedergegeben fühlt …
 Friede, Freude und Buletten auf der re-publica? Ja. Zuwenig Streit? Stimmt. Abgesehen von den üblichen Sticheleien (vorzugsweise gegen Nicht-Anwesende) habe auch ich in meiner Konferenz-Ecke keine wirklich kontroversen Debatten erlebt. Ungefähr sechshundertachtzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die erste Reihe allzu oft unter sich schwadronieren lassen – aber wer kann sich schon darüber beschweren, ohne mit eigenen Nase zu kollidieren?
Friede, Freude und Buletten auf der re-publica? Ja. Zuwenig Streit? Stimmt. Abgesehen von den üblichen Sticheleien (vorzugsweise gegen Nicht-Anwesende) habe auch ich in meiner Konferenz-Ecke keine wirklich kontroversen Debatten erlebt. Ungefähr sechshundertachtzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die erste Reihe allzu oft unter sich schwadronieren lassen – aber wer kann sich schon darüber beschweren, ohne mit eigenen Nase zu kollidieren?